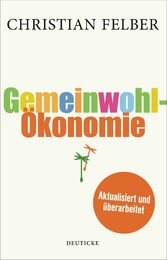
Die Gemeinwohl-Ökonomie - Ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft
von: Christian Felber
Deuticke im Paul Zsolnay Verlag, 2018
ISBN: 9783552063853
Sprache: Deutsch
256 Seiten, Download: 1459 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
1. Kurzanalyse
»Zu kooperieren, anderen zu helfen und Gerechtigkeit walten zu lassen ist eine global anzutreffende, biologisch verankerte menschliche Grundmotivation. Dieses Muster zeigt sich über alle Kulturen hinweg.«6
Joachim Bauer
Menschliche Werte – Werte der Wirtschaft
Merkwürdig: Obwohl Werte die Grundorientierung, die »Leitsterne« unseres Lebens sein sollten, gelten heute in der Wirtschaft ganz andere Werte als in unseren alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen. In unseren Freundschafts- und Alltagsbeziehungen geht es uns gut, wenn wir menschliche Werte leben: Vertrauensbildung, Ehrlichkeit, Wertschätzung, Respekt, Zuhören, Empathie, Kooperation, gegenseitige Hilfe und Teilen. Die »freie« Marktwirtschaft beruht auf den Systemspielregeln Gewinnstreben und Konkurrenz. Diese Anreizkoordinaten befördern Egoismus, Gier, Geiz, Neid, Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Dieser Widerspruch ist nicht nur ein Schönheitsfehler in einer komplexen oder multivalenten Welt, sondern ein kultureller Keil; er spaltet uns im Innersten – sowohl als Individuen als auch als Gesellschaft.
Werte sind Leitsterne
Der Widerspruch ist deshalb fatal, weil Werte das Fundament des Zusammenlebens sind. Nach ihnen setzen wir uns Lebensziele, an ihnen orientieren wir unser Handeln und verleihen diesem Sinn. Die Werte sind wie ein Leitstern, der unserem Lebensweg eine Richtung vorgibt. Aber wenn unser Leitstern des Alltags in eine ethische Richtung weist – Vertrauensbildung, Kooperation, Teilen – und plötzlich in einem Teilbereich des Lebens, der Marktwirtschaft, ein zweiter »Leitstern« in die exakt entgegengesetzte Richtung – Egoismus, Konkurrenz, Gier – zeigt, dann bricht in uns ein heilloser Widerspruch auf: Sollen wir uns solidarisch und kooperativ verhalten, einander helfen und stets auf das Wohl aller achten? Oder zuerst den eigenen Vorteil im Auge haben und die anderen als RivalInnen und KonkurrentInnen kurzhalten? Das Abgründige des Zwiespalts ist: Der Gesetzgeber bevorzugt den falschen Leitstern. Er setzt ihn in Recht – und fördert damit Werte, unter denen wir alle leiden. Das ist nicht unbedingt sofort ersichtlich, weil in keinem Gesetz steht: Du sollst egoistisch, gierig, geizig, rücksichts- und verantwortungslos sein. Aber im Gesetz steht, dass wir in der Wirtschaft nach Finanzgewinn streben und einander konkurrenzieren sollen. Das steht in zahlreichen Gesetzen, Regulierungen und Abkommen der Nationalstaaten, der EU und der Welthandelsorganisation WTO. Die Folge ist das epidemische Auftreten asozialer Verhaltensweisen in der Wirtschaft. Nicht weil der Mensch von Natur aus schlecht ist, sondern weil die Spielregeln unsere Schwächen fördern anstatt unsere Tugenden.
Aus Egoismen wird Gemeinwohl
Der »Imperativ«, dass wir in der Wirtschaft einander konkurrenzieren und nach größtmöglichem persönlichen Finanzgewinn streben (= uns egoistisch verhalten) sollen, rührt aus der – eigentlich zutiefst paradoxen – Hoffnung, dass sich das Wohl aller aus dem egoistischen Verhalten der Einzelnen ergäbe. Diese Ideologie wurde vor 250 Jahren in der Bienenfabel von Bernard Mandeville begründet, die den bezeichnenden Untertitel »Private Laster, öffentliche Vorteile« trägt.7 Auch bei Adam Smith, dem ersten großen Nationalökonomen, finden wir diese Hoffnung: »Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Bäckers, Brauers erwarten wir unsere tägliche Mahlzeit, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen.«8
Es geht mir nicht um die Anklage von Smith, der auch ein Hohelied auf das Mitgefühl (»sympathy«) gesungen und ein dickes Buch über »ethische Gefühle« verfasst hat.9 Zum damaligen Zeitpunkt ist ein solcher Satz verständlich: Das Verfolgen des Eigeninteresses der »Individuen« war neu, die »Unternehmen« überwiegend winzig und machtlos, außerdem lokal eingebunden und persönlich verantwortlich: Unternehmensgründer, Eigentümer, Arbeitgeber und Arbeitnehmer bildeten in vielen Fällen noch eine Personalunion. Es gab keine anonymen, globalen Aktiengesellschaften, keinen freien Kapitalverkehr und keine milliardenschweren Investmentfonds.
Adam Smith hoffte, dass eine »unsichtbare Hand« die Egoismen der Einzelakteure zum größtmöglichen Wohl aller lenken würde. Aus metaphysischer Sicht – Smith war Moralphilosoph – mag er die Hand Gottes gemeint haben.10 Oder es war einfach eine Hoffnung. Nichts gegen die Hoffnung, doch sie ist weder eine wissenschaftliche Methode geschweige denn eine wirksame Politikmaßnahme. Dazu bräuchte es eine sichtbare Hand, welche die Unternehmen dazu anreizt, sich so zu verhalten, wie es die Gesellschaft wünscht. Manche Ökonomen glauben, dass es sich um die Konkurrenz handle. Denn welchem Mechanismus, wenn nicht der Konkurrenz, verdanken wir, dass kein Unternehmen seinen Egoismus zu sehr auf Kosten anderer steigern kann? Sobald es zu hohe Preise verlangen oder zu niedrige Qualität bieten würde, würde es von anderen verdrängt: Wettbewerb. Bis heute bildet die Annahme, dass die Egoismen der Einzelakteure durch Konkurrenz zum größtmöglichen Wohl aller gelenkt würden, den Legitimationskern der kapitalistischen Marktwirtschaft. Aus meiner Sicht ist diese Annahme jedoch ein Mythos und grundlegend falsch; Konkurrenz spornt zweifellos auf ihre Weise zu Leistung an (dazu später), aber sie richtet einen ungemein größeren Schaden an der Gesellschaft und an den Beziehungen zwischen den Menschen an.11 Wenn Menschen als oberstes Ziel ihren eigenen Vorteil anstreben und gegeneinander agieren, lernen sie, andere zu übervorteilen und dies als richtig und normal zu betrachten. Wenn wir jedoch andere übervorteilen, dann behandeln wir sie nicht als gleichwertige Menschen: Wir verletzen ihre Würde.
Würde ist der höchste Wert
Wenn ich die Studierenden in meiner Vorlesung an der Wirtschaftsuniversität frage, was sie unter »Menschenwürde« verstehen, ernte ich regelmäßig geschlossenes und betretenes Schweigen. Sie haben im bisherigen Verlauf ihres Studiums nichts darüber gehört oder gelernt. Das ist umso erschreckender, als die Würde der höchste aller Werte ist: Sie ist der erstgenannte Wert im Grundgesetz und bildet die Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Würde heißt Wert und meint den gleichen, bedingungslosen, unveräußerlichen Wert aller Menschen. Würde bedarf keiner »Leistung« außer der nackten menschlichen Existenz. Aus dem gleichen Wert aller Menschen erwächst unsere Gleichheit in dem Sinne, dass in einer Demokratie alle Menschen die gleichen Freiheiten, Rechte und Chancen genießen sollen. Und nur wenn tatsächlich alle die gleichen Freiheiten genießen, ist die Bedingung gegeben, dass alle auch wirklich frei sein können: Menschenwürde ist die Begründung und Voraussetzung für Freiheit. Immanuel Kant sagte: Die Würde kann im alltäglichen Umgang zwischen den Menschen nur dann gewahrt werden, wenn wir uns stets als gleichwertige Personen betrachten und behandeln: Wir sollen unser menschliches Gegenüber und seine/ihre Bedürfnisse, Gefühle und Meinungen gleich ernst nehmen wie die eigenen – als Ausdruck des gleichen Wertes. Wir dürfen die andere Person nie nur instrumentalisieren und primär als Mittel für den eigenen Zweck verwenden. Dann wäre es mit der Würde vorbei.12 Als Nebeneffekt dürfen uns aus der würdevollen Begegnung sehr wohl Vorteile erwachsen, das passiert nach Kant und Hausverstand ganz automatisch, wenn alle das Beste füreinander wollen, eine Vertrauensbasis aufbauen, sich ernst nehmen, einander zuhören und wertschätzen. Aber Vorteilnahme darf nicht das Ziel der Begegnung sein.
Auf dem freien Markt ist es hingegen legal und üblich, dass wir unsere Nächsten instrumentalisieren und dabei ihre Würde verletzen, weil es nicht unser Ziel ist, diese zu wahren. Die Würde wird weder gemessen noch bilanziert. Unser Ziel ist das Erringen eines persönlichen Vorteils, und dieser lässt sich in vielen Fällen leichter erringen, wenn ich meinen Nächsten übervorteile und dabei seine Würde verletze. Entscheidend sind meine Einstellung und meine Priorität: Geht es mir um das größtmögliche Wohl und die Wahrung der Würde aller, wovon ich selbst automatisch auch betroffen bin und profitiere, oder geht es mir vorrangig um mein eigenes Wohl und den eigenen Vorteil, aus dem auch andere Vorteile ziehen können, aber eben nicht müssen?
Wenn wir unseren eigenen Vorteil als oberstes Ziel verfolgen, wird es gängige Praxis, dass wir andere als Mittel für unsere Zwecke benutzen und diese übervorteilen. Deshalb führt die Smith’sche Verdrehung von Ziel und Nebeneffekt zur weitverbreiteten Verletzung der Menschenwürde und zur systematischen Einschränkung der Freiheit vieler Menschen: So wie es das »Wohlwollen« des Lehrers, des Arztes und des Kochs braucht, damit es den SchülerInnen, PatientInnen und Hungrigen gut geht, braucht es genauso das Wohlwollen des Bäckers, Metzgers, Brauers, damit alle ihr »tägliches Brot« erhalten – und nicht nur sie. Adam Fergusson, Landsmann von Smith, sah das genauso: »Wer um das Wohl der anderen bemüht ist, bemerkt, dass das Glück der anderen zur reichhaltigsten Quelle fürs eigene Glück wird.«13
»Freier« Markt?
Der »freie Markt« wäre dann ein freier Markt, wenn alle TeilnehmerInnen dieses Treibens von jedem Tauschgeschäft völlig schadlos zurücktreten...










